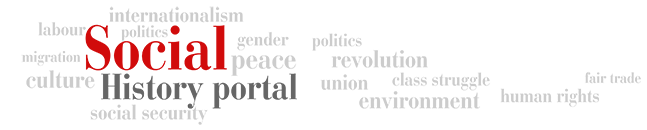Conference in Halle (Germany), 20-21 November 2025
Die Tagung widmet sich den dunklen Seiten der Industriekultur: Zwangsarbeit, Rüstungsproduktion, Arbeitsunfälle und strukturelle Gewalt. Beiträge aus Wissenschaft, Museen, Gedenkstätten, Vereinen und Unternehmen sind eingeladen, Formen unfreier Arbeit, gewaltvoller Arbeitsbeziehungen und erinnerungskultureller Verantwortung zu beleuchten. Ziel ist es, Industriekultur in Sachsen-Anhalt und darüber hinaus kritisch zu reflektieren und Fragen von Identität und Verantwortung neu zu verhandeln. Vorschläge können aus vergleichender oder transregionaler Perspektive eingereicht werden.
Arbeit, Gewalt und Zwang. Industriekultur und Verantwortung
Industriekultur wird häufig von einer Fortschrittsgeschichtsschreibung begleitet. Menschlicher Erfindergeist, Solidarität am Arbeitsplatz und im Arbeitskampf sowie unternehmerische Risikofreude bilden üblicherweise das Koordinatensystem, in dem Industriekultur erzählt und vermittelt wird. Tatsächlich existieren zahlreiche Verbindungen zwischen industrieller Entwicklung und Gewaltstrukturen, wie Zwangsarbeit oder prekären Arbeitsbedingungen. Auch die Rüstungsindustrie als eine auf Zerstörung gerichtete Produktion spielt in industriekulturellen Großerzählungen nur selten eine Rolle. Dies gilt insbesondere für das Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalts, dessen industrielle Entwicklung wie die kaum einer anderen Wirtschaftsregion Europas mit den Gewaltverbrechen des 20. Jahrhunderts verbunden ist. Die Tagung stellt Fragen nach den verschiedenen Formen von Arbeit, Gewalt und Zwang seit dem Ersten Weltkrieg bis heute und damit einhergehend nach Formen der öffentlichen Erinnerung und Verantwortung von Institutionen. Wie können diese negativen Folgen und Voraussetzungen von industrieller Entwicklung in ein Narrativ von Industriekultur in Sachsen-Anhalt eingebettet werden? Wie verhalten sich also Identität und Verantwortung, Erinnerung an die industrielle Arbeitswelt und Gedenken an staatliche Massenverbrechen, zueinander?
Die Tagung wird initiiert vom Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e. V. und dem Institut für Landesgeschichte am LDA Sachsen-Anhalt in Kooperation mit dem Netzwerk Industriekultur, dem Museumsverband Sachsen-Anhalt sowie der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt.
Eingeladen sind Beiträge aus den Bereichen Wissenschaft, Museen, Gedenkstätten, ehrenamtliches Engagement sowie weiteren erinnerungspolitisch relevanten Institutionen.
Mit den Beiträgen soll eine Diskussion eröffnet werden, in der danach gefragt wird, welche Formen von Gewalt mit Industrie verbunden sind oder durch Industriezweige befördert werden. Im Fokus steht der mögliche Umgang mit der Geschichte von Gewalt an Orten der Industriekultur sowie in industriekulturellen Großerzählungen. Mögliche Beispiele ergeben sich aus heutigen und früheren Initiativen des Gedenkens sowie über Fallbeispiele der Industriegeschichte selbst und ihrer Thematisierung in Museen als Orten der Erinnerungskultur. Neben öffentlichen Institutionen erarbeiteten auch zahlreiche ehrenamtlich engagierte Personen Gedenkorte an Zwangsarbeit. Die ehemaligen Produktionsorte der Rüstungsindustrie von Kriegstechnik (Magdeburg), über Sprengstoffe (Coswig) bis hin zur chemischen Entwicklung des Giftgases Zyklon B (Dessau) weisen teils bereits durch die Arbeitsbedingungen schwerwiegende Verletzungen und tödliche Unfälle aus. Davon unbenommen sind die Erzeugnisse der Produktionen mit Tötungsabsicht hergestellt worden. Darüber hinaus können auch die Arbeitsbedingungen in der Braunkohlen- und in der chemischen Industrie der DDR Thema sein, die Ausbeutung und Ausgrenzung mit sich brachten wie die der (politischen) Strafgefangenen und der Bausoldaten oder von ausländischen Arbeiter:innen. Ebenso können mehr-als-menschliche Beziehungen, der Umgang mit Tieren im Kontext von Krieg, Gewalt und Industrie thematisiert werden.
Insgesamt erbitten wir Vorschläge aus den folgenden vier Themenbereichen der sachsen-anhaltischen Industriegeschichte, gerne in vergleichender oder transregionaler Perspektive:
1. Unfreie Arbeit: Welche Formen und Ausprägungen unfreier Arbeit lassen sich in der sachsen-anhaltischen Industriegeschichte identifizieren? Welche Bedeutung erlangten Formen unfreier Arbeit in der Industriegeschichte des Landes?
2. Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten: Wie können Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten als Thema der Industriegeschichte und der Landesgeschichte erforscht und vermittelt werden? Welche spezifischen Strukturen des Umgangs mit Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten bildeten sich heraus?
3. Arbeitsbeziehungen: Welche gewaltvoll strukturierten Arbeitsbeziehungen lassen sich identifizieren? Welche Bedeutung haben Sexismus, Rassismus und Klassismus in der Industriegeschichte sowie der Erinnerung?
4. Unternehmen: Welche Unternehmensgeschichten lassen sich in die Geschichte von Industrie und Gewalt einordnen? Welche Bedeutung haben dabei insbesondere Unternehmen der Rüstungsindustrie? Welche Verbindung sachsen-anhaltischer Unternehmen zu staatlichen Gewaltverbrechen des 20. Jahrhunderts lassen sich identifizieren?
Analytisch begrüßen wir sowohl Beiträge aus dem Bereich der Arbeits-, Wirtschafts-, Unternehmens- und Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts als auch aus der Erinnerungsgeschichte sowie der Museologie. Besonders freuen wir uns über Vorschläge von zivilgesellschaftlichen Initiativen und Vereinen.
Einreichungen von Themenvorschlägen im Umfang von 300 Wörtern und einer biographischen Notiz bitte bis zum 15. Juni 2025 an info@lhbsa.de
Reisekosten werden übernommen. Eine Publikation ist vorgesehen.
Rückfragen an: John Palatini (palatini@lhbsa.de) / Dr. Jan Kellershohn (jkellershohn@lda.stk.sachsen-anhalt.de) / Justus Vesting (jvesting@lda.stk.sachsen-anhalt.de)
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e. V.
E-Mail: info@lhbsa.de