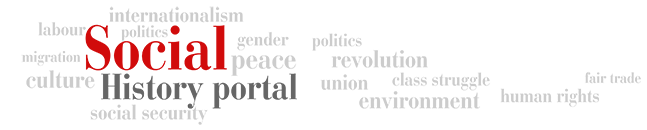Colloquium "Comptabilité et action publique. Rendre (des) compte(s)" (French)
Paris/France
Outre les héritages de l’Ancien Régime et de la Révolution, c’est surtout depuis la Restauration que la comptabilité publique permet de collecter, classer et contrôler les données budgétaires et comptables. D’un instrument de contrôle et de reddition, elle a progressivement évolué, au gré des réformes, vers un outil de pilotage et d’aide à la décision documentant la situation financière du secteur public et alimentant l’évaluation des politiques publiques. Souvent réduite à une dimension « froide » et technique, la comptabilité publique constitue au contraire un outil opérationnel pour appréhender différentes réalités économiques et sociales et tenter d’agir sur elles.
PrésentationLa 24e édition des Rencontres internationales de la gestion publique (RIGP) aura lieu le jeudi 8 janvier 2026 au Centre de conférences Pierre Mendès France des ministères économiques et financiers. Ces rencontres porteront sur le thème « Comptabilité et action publique : rendre (des) compte(s) ».
Outre les héritages de l’Ancien Régime et de la Révolution, c’est surtout depuis la Restauration que la comptabilité publique permet de collecter, classer et contrôler les données budgétaires et comptables. D’un instrument de contrôle et de reddition, elle a progressivement évolué, au gré des réformes, vers un outil de pilotage et d’aide à la décision documentant la situation financière du secteur public et alimentant l’évaluation des politiques publiques. Souvent réduite à une dimension « froide » et technique, la comptabilité publique constitue au contraire un outil opérationnel pour appréhender différentes réalités économiques et sociales et tenter d’agir sur elles. Ces RIGP s’intéresseront donc à la manière dont les normes comptables ainsi que leurs transformations dans le temps ont influencé le pilotage de l’action publique, jusqu’à aborder les thématiques comptables les plus récentes comme la comptabilité verte ou le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
Les RIGP sont chaque année une occasion privilégiée d’échanges entre praticiens de l’action publique et chercheurs, français et étrangers, faisant une grande place à la dimension comparative. Lieu où confronter des points de vue, la journée est organisée autour d’une conférence introductive, d’entretiens, de débats et de tables rondes.
Programme Jeudi 8 janvier9 h/9 h 15 : Mot d’accueil et ouverture
9 h 15/10 h : Conférence inaugurale
Comptabilité et action publique : un aperçu historiqueIntervenant
- Sébastien Kott, professeur des universités en droit public et délégué à la stratégie de recherche de l’INSP
10 h/10 h 15 : Pause-café
10 h 15/11 h 30 : Table ronde 1
Rendre compte de l’action publique par les comptesIntervenant.es
- Amélie Verdier, directrice générale des Finances publiques des ministères économiques et financiers
- Rouba Chantiri, maîtresse de conférences en sciences de gestion à l’université Paris-Dauphine
- Eugenio Caperchione, professeur de management public et de comptabilité publique à l’université de Modène et Reggio Emilia
11 h 30/12 h : Entretien
Une nouvelle responsabilisation des gestionnaires publics ?Intervenante
- Céline Husson-Rochcongar, maîtresse de conférences en droit public à l’université de Picardie-Jules Verne et directrice de la recherche de l’INSP
12 h/13 h 15 : Pause déjeuner
13 h 15/14 h 45 : Table ronde 2
Les comptes, outil pour plus de transparence de l’action publique ?Intervenant·es
- Paul Hernu, conseiller maître honoraire à la Cour des Comptes
- Robert Ophèle, président du collège de l’Autorité des normes comptables
- Evelyne Lande, professeure des universités en sciences de gestion à l’université de Poitiers
- Fabienne Colignon, cheffe de mission expérimentée au Conseil de Normalisation des Comptes publics
14 h 45/15 h 15 : Entretien
Quelles actualités de la normalisation comptable publique en France ?Intervenante
- Marie-Christine Lepetit, présidente du Conseil de Normalisation des Comptes publics
15 h 15/15 h 30 : Pause-café
15 h 30/16 h : Débat/échange
Verdir l’action publique par les comptes ?Intervenants
- Sébastien Roux, directeur du programme des comptes nationaux augmentés, Insee
- Alexandre Rambaud, maître de conférences en sciences de gestion à AgroParisTech
16 h/16 h 30 : Grand témoin
Intervenant
- Michel Prada, directeur de la comptabilité publique de 1978 à 1985, puis du budget de 1985 à 1988, président de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) de 2003 à 2008 et président du CNoCP de 2009 à 2024.
16 h 30 : Clôture
Informations pratiquesInscription gratuite mais obligatoire à l’adresse suivante : https://catalogue.igpde.finances.gouv.fr/2127-24emes-rigp-comptabilite-et-action-publique-rendre-des-comptes.html
Un tutoriel est disponible : https://cdn-media.web-view.net/i/xxawssuc/Support_inscription_evenement(1).pdf ?v =1764167026
Une pièce d’identité sera demandée à l’accueil du ministère pour accéder à l’événement.